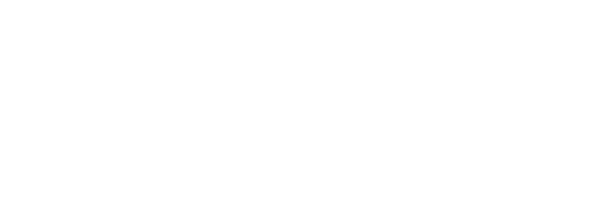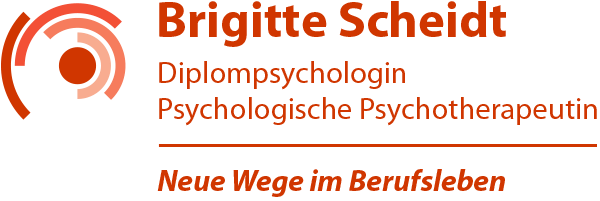Private Profis – Die Krise lässt die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatwelt durchlässiger werden. Nicht jeder kann gut damit umgehen.
F.A.Z., 23.05.2020, Beruf und Chance , Seite C1 | Ursula Kals
Die Katze ist krank, die Oma dement, das Homeschooling der Kinder anstrengend: Private Gespräche tun gut und sind ein wichtiger Aspekt der persönlichen Bindung zum Arbeitsplatz. Doch die Corona-Krisenzeit bietet viel mehr Einblicke in Privates, als wir es gewöhnt sind. Das beginnt bei Schwenks in Küchenbüros und hört bei indiskreten Diskussionen, wer Vorerkrankungen mit sich herumträgt, nicht auf. Aber wie viel Privates verträgt die Arbeit in der Pandemie? Und ganz generell?
“Darauf gibt es keine Standardantwort. Es kommt stark drauf an, in was für einer Firmenkultur man steht”, sagt Karsten Drath, Unternehmensberater aus Frankfurt. “In einem Start-up ist es kein Problem, zur Videokonferenz im Hoody zu erscheinen, hinten Kind, Hund und Abwasch im Bild, das macht es menschlicher. Keiner hat die perfekte, klinische Büroausstattung. Wir müssen zusammen da durch, das stärkt das Wir-Gefühl. Grabenkämpfe werden beiseitegeschoben.” In seinem Managementteam gebe es ein virtuelles Stand-up, eine halbe Stunde einwählen ohne starre Agenda. “Das ist nach diesen Wochen ein stabilisierender Faktor geworden, eine große Teambuilding-Maßnahme. Wir wissen voneinander, dass auch Angehörige gestorben sind.” In Konzernen könne dies allerdings anders aussehen. “Ist die Unternehmenskultur eher toxisch gelagert, belastet Privatheit das Ganze zusätzlich.”
Wo zu viel Nähe nicht gewollt sei, rät er, die Privatsphäre zu schützen, virtuelle Hintergründe einzublenden und nicht zu viel preiszugeben. “Das alles hängt mit dem Thema Vertrauen zusammen.” Bei Videokonferenzen komme die Dimension des digitalen Überwachens hinzu, warnt der Ingenieur. Deshalb sei das Unternehmen Zoom in Verruf geraten. Dort lasse sich leicht tracken: Hat jemand ein anderes Fenster auf, bearbeitet er parallel seine Mails, wann ist einer online? “Das kann dazu führen, dass Mitarbeiter in eine gesunde Selbstverteidigung gehen.”
Die Psychotherapeutin Brigitte Scheidt aus Berlin rät zu einem souveränen Umgang mit Privatem: “Ich kann bestimmen, was die anderen von mir sehen, welchen Ausschnitt ich aus meinem privaten Umfeld anbiete, was ich äußere und freigebe.” Sie nennt das “selektiv authentisch sein”. Das bestätigt auch der Düsseldorfer Psychologe Jürgen Walter. Etwa bei der Wie-geht-es-Ihnen-Frage, die seit Corona nicht mehr nach Floskel klingt. “Ich muss nicht das Tiefste von innen nach außen kehren, bin dem nicht ausgeliefert und kann ein Gespräch lenken, brauche aber Strategien. Zum Beispiel kann ich sagen: ,Das ist interessant, was Sie fragen. Wie ist das denn bei Ihnen?’ Schon ist der Ball zurück, ich habe Zeit gewonnen, um das Thema zu wechseln.” So habe man die Möglichkeit, Nähe herzustellen, aber eben auch, Nähe abzuwehren und freundlich zu sagen: “Sorry, darüber kann ich im Augenblick nicht reden.”
Extrovertierten Menschen kommt so ein Satz eher nicht über die Lippen. Sie tappen gerade jetzt unbedarft in die Plaudertaschen-Falle. Auch manche Berufseinsteiger, gewöhnt an das Uni-Milieu, sollten privatplaudertechnisch vorsorglich auf die Bremse treten. “Gebe ich zu viel preis, von meinen wechselnden Beziehungen, finanziellen Sorgen, macht mich das angreifbar. Menschen, die zu extrovertiert sind, merken das oft nicht, sie haben kein Gespür dafür”, sagt Jürgen Walter. Kann man solche Kollegen ausbremsen? Der Coach zögert. “Das Thema hat viel zu tun mit dem Selbstbild und dem Fremdbild. Es ist eine hohe Fähigkeit, andere zu fragen: ,Sei doch mal ganz offen, habe ich das richtig gemacht, wie schätzt du mich ein?’ Viele wollen gar nicht wissen, wie sie wirken, weil sie Angst vor Kritik haben.” Der Leidensdruck steige erst, wenn sie merkten, dass das, was sie gutgläubig gesagt haben, gegen sie verwendet werde. Walter berichtet von einem Fall, da bat der Chef ihn: “Sprechen Sie bitte mit meiner Mitarbeiterin, die redet von ihren schwierigen Ehen und Kindern, die Kollegen stoppen sie zu wenig.”
Omnipräsentes Thema Krankheit
Dieses Stoppen dürfte momentan nicht leichter geworden sein. “Corona ist für die meisten etwas Neues. Als kollektive Erfahrung werden wir alle mit unserer Verletzbarkeit konfrontiert”, sagt Brigitte Scheidt. Das intime Thema Krankheit ist omnipräsent. Stark übergewichtige, stark rauchende oder einfach nur ältere Kollegen stehen ungewollt im Fokus. Plötzlich wird mehr nachgefragt und aufmerksamer hingehört, wenn von pflegebedürftigen Verwandten erzählt wird. Das befeuert Skepsis: Sind diese Kollegen womöglich Virenbeschleuniger, absorbiert das zu viel Kraft für ihre Tätigkeit? Das Wort Risiko hat eine hohe Frequenz. Nicht allen gelingt es, eine gute Balance herzustellen zwischen gebotener Sachinformation und der Erkenntnis, lieber mal den Mund zu halten. Ohne es zu wollen, heizen auskunftsfreudige Mitarbeiter die Gerüchteküche an mit unabsehbaren Folgen. “Sie haben wenig Verständnis für soziale Strukturen, dafür, wie ein System funktioniert”, warnt Jürgen Walter. “Auch wenn es legerer zugeht, es ist immer noch der Arbeitskontext”, sagt Karriereberaterin Scheidt und argumentiert grundsätzlich: “Es geht darum, dass das, was ich tue, eine Wirkung hat. Das ist nicht allen bewusst.” Kleine Pannen seien indes verzeihlich. “Wenn ich eine Woche schwächele, mich mit Telkos schwertue, ist das nicht schlimm. Es ist eine Lernsituation, in die Corona uns wirft. Da sind die einen etwas schneller, die anderen langsamer.” Ausschweifend darüber zu reden, empfiehlt sie nicht. Vieles ruckele sich zurecht, fast so wie die verwackelten Konferenzbilder.
Was aber tun, wenn es nicht um technische Pannen, sondern eine handfeste Krise in der Krise geht? Wenn die Pandemie eine hypochondrische Panik, eine Depression auslöst.Soll ich das sagen? Brigitte Scheidt rät zur Vorsicht. Zwar könne man sagen, wenn es einem zeitweise nicht gutgeht. Doch grundsätzlich sei auch die Gefahr groß, als nicht belastbar abgestempelt zu werden. “Zunächst sollten Familie und Freunde das Auffangbecken sein, wenn ich mich selbst wenig regulieren kann. Oder man holt sich eine Krankschreibung.” Helfe diese situativ-adäquate Unterstützung nicht, rät Scheidt, mit dem Vorgesetzten im Vier-Augen-Gespräch zu reden und anzuregen, “eine gemeinsame Lösung für diese jetzt schwierige Phase zu finden. Das ist eine Ausnahme in einer Ausnahmesituation.” Depression sei immer noch ein Tabu, bestätigt Jürgen Walter, der als Sportpsychologe mit Fußballern arbeitet, die nach überwundener Erkrankung “mental wieder stabil” seien. Das Spiel mit falschen Karten sei gerade im Leistungssport gang und gäbe. Denn, darin sind sich die Gesprächspartner einig, die Gefahr besteht – im Sport wie in allen anderen Berufen -, nach der Phase einer “Schwäche” für eine Beförderung nicht mehr gesehen zu werden. Eine Zeitlang Dienst nach Vorschrift zu machen und das mit dem Vorgesetzten abzusprechen sei hingegen in Ordnung.
Ob nach Überstehen der Pandemie die Arbeitswelt tatsächlich humaner werden wird? Das scheint wünschenswert, aber ungewiss. “Vielleicht gibt es mehr Zusammenhalt, das Umdenken, nur in der Gruppe stark zu sein, weniger Mobbing, Demut vor dem Erfolg und Dankbarkeit, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben”, sagt Jürgen Walter. “Sicher ist das nicht. Da gibt es noch zu viele ungeklärte Fakten.” Brigitte Scheidt ist eine gewisse Skepsis anzumerken, ob die Arbeitswelt lässiger werde. “Hellseherin bin ich nicht. Was sicherlich stimmt: Es dringt mehr in den Privatbereich ein.” Aber auch das gelte nicht für alle: Auch im Homeoffice könne man sich abkapseln und acht Stunden lang einfach die Tür zumachen.
Dass in dieser Krise manche Mitarbeiter länger als andere im Homeoffice bleiben, kann ebenso für Verunsicherung sorgen. Manche Geschäftsleitungen stellen die Rückkehr anheim: Wenn sich Mitarbeiter um ihre Gesundheit sorgen, sich unwohl mit dem Gedanken fühlen, tagtäglich vielen zu begegnen, können sie weiterhin von zu Hause aus arbeiten. “Es gibt Unternehmenskulturen, da ist es nicht so eine große Sache und absolut okay, es bedarf keiner Erklärung. Das ist ein kluger Ansatz”, findet Führungskräfte-Coach Karsten Drath. Und Brigitte Scheidt gibt zu bedenken: “Dass viele jetzt mehrfach belastet erscheinen, ist keine persönliche Schwäche, das ist eine Lebenssituation. Corona ist durch Ambivalenz gekennzeichnet.”
Aber ist das nur eine Pseudofreiheit? Bleiben in der Wahrnehmung der Hartgesottenen nur die Weicheicher daheim? Drath sieht das nicht so: “Das Management kann nur Richtlinien vorgeben und diese gut gestalten. Länger von zu Hause zu arbeiten ist in Ordnung und Teil einer neuen Corona-Normalität.” Nachteile sieht er darin nicht. Er ist ohnehin optimistisch, was den Umgang mit vermeintlichen persönlichen Schwächen angeht. “Bei Kunden, mit denen wir arbeiten – in der Beratung, im produzierenden Gewerbe, in der IT, im Bereich Konsumgüter -, erlebe ich überall, dass es menschlicher wird, dass es normaler wird, dass man Grenzen hat und auch darüber sprechen kann.” Der CEO eines Automobilzulieferers erzähle etwa offen, wie ihm die Kurzarbeit an die Nieren geht. “Er wirkt souveräner, weil er auch mal schwach ist.” Karsten Drath findet es in dieser Zeit eher “irritierend, wenn einer unangefochten wie aus dem Ei gepellt dasitzt. Wir sind doch nur Menschen, die sich nicht in ein Verhaltenskorsett pressen lassen.”
Vieles wird jetzt neu austariert
Dennoch: Schwachstellen offenzulegen macht angreifbar, über kurz oder lang könnten da miese Charaktere reingrätschen. “Man darf am Arbeitsplatz Schwächen zeigen, sollte sich aber bewusst darüber sein, wo die Leute sind, die das ausnutzen”, findet Jürgen Walter und zitiert den Kalauer “never intim im Team”. Wer den Falschen vertraut hat, den kann das böse wieder einholen. Und sei es “nur”, dass derjenige anspielungsreiche Gerüchte über maßlose Überforderung streut, weil X seine bockigen Homeschooling-Kinder nicht im Griff habe. Denn die Wahrnehmung, dass uns die Vertrauten in Masken-Abstands-Zeiten noch vertrauter, andere noch distanzierter erscheinen, ist tückisch. Ebenso naiv ist der Glaube, dass sich in schwierigen Zeiten sofort enthüllt, wer integer ist und bei wem es nur zum Schön-Wetter-Matrosen reicht. Psychologin Brigitte Scheidt hinterfragt diese Schwarz-Weiß-Sicht: “Es kann sein, dass mir Kollegen, die mir vorher vertraut waren, jetzt fremd vorkommen, nur noch klagen und Verschwörungstheorien anhängen, und dass ich mit Kollegen, die ich nicht so leiden konnte und Vorurteile hatte, neue Gemeinsamkeiten entdecke. Es verbindet, zu sehen, die anderen sorgen sich auch um ihre alten Eltern.” Auf einmal erlebt man Kolleginnen und Kollegen von ganz anderen Seiten. “So kann neu gemischt werden, es wird neu austariert. Neue Formen der Begegnung, des Miteinanders entstehen.” Das sei wie im Freundes- und Bekanntenkreis auch, manche Beziehungen vertieften, andere lockerten sich. Manch einer erweist sich als intolerant, obgleich er den offenen Weltbürger mimte.
Karsten Drath bleibt unverdrossen optimistisch, dass es künftig menschlicher zugehen wird in der Arbeitswelt. Er erwähnt das vor drei Jahren viral gegangene Video des Korea-Fachmanns Robert E. Kelly, der während eines BBC-Live-Interviews im Homeoffice saß, als plötzlich seine Kinder durchs Bild wuselten. “Heute wäre das keine große Sache mehr, der Mann würde sie auf den Schoß nehmen”, mutmaßt Drath. “Wir sind Menschen mit Ecken und Kanten. Das ist sympathisch.” Vorsicht ist dennoch geboten. Laut einer Umfrage wirken Männer kompetenter, wenn sie sich im Homeoffice mit Kind und Katze zeigen. Toll, ein ganzer Kerl, der wuppt noch sein Familienleben, heißt es dann. Frauen werden hingegen in vergleichbaren Situationen als unprofessionell wahrgenommen. Sie sollten den Anhang lieber vorübergehend aussperren, rät Jürgen Walter. “Das ist schade, aber taktisch klüger. Diese ungeschriebenen Gesetze muss man mitspielen, wenn man Erfolg haben will.”
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv
Foto: © Chris Montgomery / unsplash.com